
Die vorgestellten Geschichten entstehen zwischendurch.
„Der Zeitschrei“, „Das Ding der Unmöglichkeit“, „Der schöne Albtraum“ oder „Quedlinburger Philosophentreff“ schon in den frühen 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts.
„Der erste Tag Armaggeddons“ ist meine Lieblingsgeschichte (Winter 01/02).
„Puschel“ ist eine Weihnachtsgeschichte der spiritussigen Art und endet trotzdem erst in 1000 Jahren.
„Lustige Zeiten“ gehören zu einer Anthologie und sind schön nostalgisch.
Dann gibt es noch die Geschichten „Sommereis“ und „Zeitfluss und Impotenz “.
Auch „Das Diadem des Chronos“ war ein Wettbewerbs-Beitrag. Ich erfuhr niemals, was daraus geworden ist...
Der erste Tag Armaggeddons
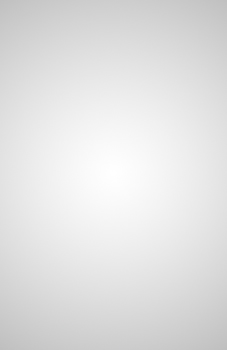
"Der erste Tag Armaggeddons"
von Christian Amling
Der Tag begann keineswegs aufregend und, um ehrlich zu sein, kann ich mich an die Ereignisse des Vormittags überhaupt nicht mehr erinnern. Ich glaube, eine spätsommerliche Sonne erwärmte mäßig den Wald, wurde aber schnell von aufziehenden Wolken verdeckt.
Wir hatten ein sehr gutes Pflaumenjahr und die Bäume, die niemand mehr abschüttelte, hingen brechend voller Früchte. Dagmar kam mit dem Hund aus der Plantage zurück und schüttete einen halben Zentner der blauglänzenden Zwetschgen, die vor kurzem noch auf knorrigen, schwarzen Zweigen gehangen hatten, aus ihrem Arafat-Tuch und aus allen Hosen- und Jackentaschen auf den ausladenden Küchentisch.
Als ich sie mißtrauisch ansah, erklärte sie voller Vorfreude: "Ich backe heute einen Pflaumenkuchen."
"Oh!" kam es aus mir, ehrlich erstaunt, denn Kuchenbacken gehörte bei uns zu den ganz außergewöhnlichen Handlungen.
Alsbald fing sie damit an, einen jener hochsensiblen Hefeteige zu knetschen, die man weder einem Luftzug noch einem Temperaturschock aussetzen darf. Eigentlich darf man in ihrer Gegenwart gar nichts, sie nicht blöd angucken und auch nicht laut sprechen, aber vor allen Dingen darf man nicht husten.
Weil die Backröhre des fossilen Elektroherds in der großen Küche unseres einsamen Waldhauses schon vor geraumer Zeit den Geist aufgegeben hatte, wollte Dagmar den Kuchen bei unserem Sohn backen. Der wohnt unten im Tal in einer alten Industriebrache, etwa siebenhundert Meter von uns entfernt und fünfzig Höhenmeter tiefer gelegen. Zufuß hätte sie hunderte von Metern bergauf und bergab durch den Wald gehen, eine Landstrasse und ein Flüßchen überqueren und noch eine ganze Strecke auf einer holprigen Zufahrt zurücklegen müssen.Und da die Hefe noch nicht gezüchtet wurde, die diese Strapazen überlebt hätte, plazierte sie das Blech, nachdem sie es fix und fertig mit Hefeteig und Pflaumen belegt hatte, gehüllt in schützende Tücher, vorsichtig auf die Rücksitze unseres alten Autos.
Gegen drei Uhr machte sie sich mit dieser Ladung entschlossen auf den Weg in ihre Zukunft. Zuvor hatten wir allerdings vereinbart, daß ich ihr in einer Stunde zufuß folgen würde, um meinerseits mit dem Auto zu einer Sitzung zu fahren, an der ich an diesem Tag noch teilnehmen wollte.
Also klemmte ich mir kurz vor Vier den braunpappenen A4-Umschlag mit den Sitzungsunterlagen unter den Arm und machte mich auf den Weg.
Die Industriebrache liegt in der Flußaue, etwa zwei Kilometer von der Stadt entfernt. Eine alte Ziegelei und eine Getreidemühle siechen hier seit der Währungsunion dem Verfall entgegen.
Ich ging über die Stahlbrücke, die den rauschenden Mühlgraben passierbar macht. Neben mir ragten die zig Meter hohen Speichergebäude aus roten Klinkersteinen in den trüben Himmel, in denen vor einem Jahrzehnt noch tausende Tonnen von Weizen lagerten.
Dicht daneben duckt sich das einstöckige Werkstattgebäude, in dem unser Sohn Möbel restauriert. Die ehemalige Betriebskantine hatte er zur Wohnung umfunktioniert und die Dürftigkeit dieser Behausung wurde zumindest etwas durch die Romantik der üppigen Natur ausgeglichen, die von allen Seiten her das Menschenwerk zurückeroberte.
Schon als ich den alten Schienenstrang überquerte, auf dem früher einmal die mit Getreide und Ziegelsteinen gefüllten Waggons rangierten, wurde die Außentür geöffnet und Mutter und Sohn quollen aufgeregt daraus hervor.
"Hast du es gesehen?" riefen sie mir aufgeregt entgegen. "Der Krieg ist ausgebrochen."
"Wie sollte ich es gesehen haben? Denkt ihr, ich gucke fern, wenn ich einmal eine Stunde für mich allein bin?" fragte ich amüsiert zurück.
"New York ist angegriffen worden", sagte einer von ihnen. "Die Wolkenkratzer fallen zusammen!"
Schweigend folgte ich ihnen in die Betriebskantine, die in ein ziemlich gemütliches Nest verwandelt worden war, mit alten restaurierten Möbeln, vielen Büchern und einer Musik- und Computeranlage.
Die Freundin unseres Sohnes saß wie ein hypnotisiertes Kaninchen vor dem kleinen Fernseher, dessen Bildröhre etwa so groß wie mein brauner Briefumschlag war.
Aufgeregt kommentierte ein Fernsehsprecher die ersten Bilder von jenseits des Atlantischen Ozeans. Die Aufnahmen kamen von einem Schiff oder Flugzeug, das sich meilenweit vor Manhatten aufhalten mußte. Demzufolge sah man auch nur die vormittägliche Skyline New Yorks, die allerdings in eine gewaltige Staubwolke gehüllt war.
Der eine der beiden über vierhundert Meter hohen Türme des World Trade Centres war vor einigen Minuten in sich zusammengestürzt, weil ein mit Kerosin und Menschen vollbeladenes Flugzeug in ihn hinein gerast war. Der andere Turm ragte noch aus der monströsen Staub- und Rauchwolke, aber auch er schickte aus seinem oberen Drittel bedrohlich schwarze Rauchschwaden in den blauen Sommerhimmel. Auch in ihn hatte sich ein Flugzeug hineingebohrt, wie uns in der schnell wechselnden Bildsequenz bereits live gezeigt wurde, denn dieser zweite Treffer war natürlich bereits auf Film gebannt. Die Maschine flog eine Kurve und schlug in den zweiten Turm kurz oberhalb der Mitte ein. Dieser Turm war dann übrigens als erster zusammen gebrochen. Im nächsten Moment erreichte uns ein Foto vom Pentagon und voller Schrecken gab man bekannt, daß auch dort ein Passagierflugzeug alles in Trümmer gelegt hatte und daß die Militärzentrale der Welt in Flammen stünde.
Ich erinnere mich noch genau, daß meine erste verbale Reaktion war: "Das waren entweder die Amis selber oder die Außerirdischen."
Dann brach lautlos der andere Tower in sich zusammen. Die Skyline New Yorks wurde auf einmal merkwürdig flach und selbst das UN-Hochhaus und das Empire State Building wurden vollständig in die gigantische Staubwolke eingehüllt, die nun auf den Betrachter zuraste, als eine Million Tonnen Beton, Stahl, Glas und Plastic auf die Oberfläche der Erde schlugen.
Schwert und Waage, die Insignien des Weißen Mannes, hatten einen tödlichen Schlag erlitten. Das kam wirklich einer Kastration gleich.
Zuerst sprachen die Kommentatoren über die Unvorstellbarkeit dieses Ereignisses und das war das Erste, was uns auf die Nerven ging. Niemand konnte das ernsthaft behaupten. In meterhohen Stapeln von Büchern und Filmen war dieses Thema in den letzten fünfzig Jahren bis ins kleinste erörtert worden. Der Klassiker "Krieg der Welten" von H. G. Wells, der später als das pathetisch nationalistische Remake "Independence Day" verflacht durch die Kinos krachte, sei hierzu empfohlen, auch "Hallo Amerika" von J. G. Ballard liest sich zu diesem Thema recht gut.
Fast exakt wurde das Szenario von dem Schweizer Mönch Armin Risi abgehandelt, dessen Buch "Machtwechsel auf der Erde" im Jahr 2000 erschien. Die Umschlagsillustration dieser Ausgabe zeigt interessanterweise das hellerleuchtete WTC bei Nacht.
neben der Unvorstellbarkeit dieses Ereignisses an sich, war aber besonders unvorstellbar, was für Menschen so etwas tun konnten. Wer konnte Tausende unschuldige Menschen so grausam morden?
Angestrengt überlegten wir vier in der Betriebskantine. Mir fiel eine Szene aus meinem Lieblingsroman "Nach vielen Sommern" von Aldous Huxley ein. Er spricht darin von der dümmsten und der weisesten Stelle der Bibel. Die eine lautet: "Sie hassen mich ohne Ursache!", und die andere: "Gott läßt seiner nicht spotten Wie der Mensch sät, so soll er ernten!".
Sind es also die Indianer gewesen, deren Genozit für Gottes freiestes Land viele Millionen Tote gefordert hatte? (Sollte das jemand für zuweit hergeholt halten, sei er daran erinnert, daß noch vor 50 Jahren auf Feuerland eine Kopfprämie von 50 Dollar auf jeden getöteten Indianer ausgesetzt war.) Oder waren es die Nachfahren der Negersklaven, auf deren entwurzelten Körpern das Startkapital der Nation angelegt war? Oder waren es die Opfer der deutschen Städte, deren Zivilbevölkerung kurz vor Kriegsende in brennendem Phosphor verdampfte, oder gar die Überlebenden von Hiroshima und Nagasaki, oder die Mißgeburten der vietnamesischen Frauen, die man mit Tausenden Tonnen "Agent Orange" durchtränkt hatte?
Wir wußten es nicht ...
Vielleicht waren es ja auch die Opfer der zig Millionen amerikanischen Bodenminen, die überall auf der Welt vergraben liegen, oder die Bewohner des Kossovo, die sich mit fünfzigtausend kleinen postgelben überalterten nichtdetonierten Splitterminen herumquälen müssen, die fast täglich Kindern und Erwachsenen in Friedenszeiten die Gliedmaßen abreißen.
Oder waren es etwa die Bewohner Afrikas, denen das vorige Jahrhundert nicht viel mehr als ein Gebirge von Waffen, ein Gebirge von AIDS-Toten und ein Gebirge von Schulden bei der Weltbank gebracht hatte?
An dieser Stelle wurde es uns zu mulmig und bedrippst öffneten wir eine Flasche Sekt. Schweigend stießen wir an. Pling - Plong! Würden wir überhaupt noch den nächsten Tag erleben? Der amtierende Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika war nicht gerade berühmt für seine Weisheit und Güte. Er liebte es eher, in ödipaler Manier als Cowboy zu posieren, und er und seine trostlos überalterte Regierungsmannschaft hatte sich damals bereits den zweifelhaften Ruf erworben, getreu der Devise zu handeln: Erst schießen, dann fragen.
Nun würde es bei George Dawelju eher nicht bei blauen Bohnen bleiben, hier würden es sicherlich atomar bestückte Interkontinentalraketen sein müssen - darunter läßt sich sein Ego möglicherweise nicht befriedigen.
Ich stellte mein Sektglas ab und sagte: "Ich muß zu meiner Sitzung, sonst komme ich noch zu spät."
Eine Minute vor Fünf betrat ich den Raum für die Sitzung des Aufsichtsrates der Stadtwerke, vertreten durch ein Dutzend Männer und ausreichend für unsere kleine Stadt mit weniger als 25 000 Einwohnern. Fast alle Mitglieder waren schon anwesend und hatten sich bereits an dem großen Tisch auf ihren Stammplätzen niedergelassen. Schweigend starrten sie in die Luft und erwarteten den Beginn der Sitzung.
Sie sind so stark beanspruchte Geschäftsleute, dachte ich, daß sie noch gar nicht bemerkt haben, was passiert ist.
"Wißt ihr schon, was passiert ist?" fragte ich in den Raum hinein.
Der Steuerberater, der Rechtsamtsleiter, der Gärtnereibesitzer, der alte SPD-Funktionär aus der Partnerstadt, der Baudezernent, der Grundstücksmakler, die beiden Betriebsräte, der Partnerstadtwerkedirektor, der ehemalige DDR-Betriebsleiter, der Geschäftsführer und seine Sekretärin sahen mich über ihre vorhandenen oder imaginären Brillenränder hinweg prüfend an.
Alle wußten es bereits. Zwei oder drei von ihnen gaben einen Kommentar ab, der so lapidar war, daß ich ihn auf der Stelle wieder vergaß. (Auch Trauer kann lapidar sein ...)
Dann betrat der Bürgermeister, auf den alle gewartet hatten den Raum. Er war brandneu und hatte noch nicht die ersten hundert Tage im Amt hinter sich.
"Ehe wir mit der Sitzung beginnen", sagte er und räusperte sich etwas verlegen, denn alle der hier Versammelten besaßen im Gegensatz zu ihm schon sehr alte Stammplätze an diesem Tisch, "gestatten Sie mir einige Bemerkungen zu den tragischen Ereignissen in den Vereinigten Staaten."
Dann sprach er in gemessenem Ton davon, daß, wer auch immer diesen grausamen und durch nichts zu rechtfertigenden Anschlag ausgeübt haben möge, einen unermeßlichen Schlag gegen die Demokratie und gegen die zivilisierte Menschheit getan hätte. Um unser Mitgefühl und unsere Trauer zu bekunden, wäre es gut, in den nächsten Tagen eine Mahnveranstaltung abzuhalten, angelehnt an unsere Demos vor fast auf den Tag genau 12 Jahren gegen die DDR-Diktatur.
An diesem Punkt wurde mir klar, daß das WTC-Attentat die Menschheit in zwei Glaubenslager spaltete, die jeweils an einem der beiden vorhin erwähnten Bibelzitate von Aldous Huxley orientiert sein würden.
Die Einen werden sagen, daß es sich um ein infames Verbrechen an Unschuldigen handelt, dessen Wurzeln im Reiche des Bösen zu suchen seien und die somit kompromiss- und vor allem diskussionslos ausgerottet werden müssen. Schon wer dazu überhaupt dumme Fragen stellt, macht sich im Grenzfall strafbar, zumindest aber suspekt.
Die Anderen werden penetrant nach den Ursachen und nach den wahren Verursachern fragen. Das wird unangenehm sein, denn es stört die trauernde Gemeinde in ihrer Einigkeit. Amerika als Lokomotive der Demokratie ist sich keiner Schuld bewußt, wo gehobelt wird, da fallen Späne, und unter dem Strich ist die Bilanz tief schwarz, besser gesagt, sehr positiv.
Aber, werden die Anderen sagen, es ist doch offensichtlich, daß der American Way of Life nur einem geringen Teil der Menschheit zugute kommt, und nur deshalb, weil der größere Teil der Menschheit dafür darben muß.
Schnickschnack, werden die Einen sagen, der größere Teil der Menschheit muß ausschließlich deshalb darben, weil ihm korrupte Regime verbieten, den American Way of Life zu betreten. Wenn diese unzivilisierten Systeme erst einmal beseitigt sein werden, treten wir alle ein in die Neue Weltordnung.
Die Einen werden unermüdlich betonen, daß es niemandem auf der Welt gestattet werden darf, als gesetzloser Terrorist unschuldige Menschen zu ermorden.
Und die Anderen werden immer wieder antworten, daß dies nicht das grundsätzliche Problem sei, sondern die Beantwortung der Frage nach den Ursachen und danach, was eigentlich überhaupt geschah, in Wirklichkeit.
Und dann existiert natürlich noch die ganz heimtückische Frage, was eigentlich passiert, wenn Standpunkt Eins und Standpunkt Zwei miteinander vermischt werden.
Inzwischen waren wir in der Sitzung längst zur Tagesordnung übergegangen. Wie immer diskutierten wir darüber, wie wir den Menschen am besten mit möglichst wenig Aufwand an Geld und Personal möglichst viel Elektrizität, Gas und Wärme verkaufen können, zu einem Preis, der zwar hoch ist, aber den human verträglichen Vorgaben der Preisregulierungsbehörde artig entgegenkommt.
Gerade, als wir nach etwas über zwei Stunden auseinandergehen wollten, erreichte uns ein Anruf aus der Sonstwelt mit folgender Nachricht: Heute Abend findet in der Marktkirche ein Gottesdienst zum Gedenken der Opfer des WTC-Anschlags statt. Bitte Kerzen mitbringen ...
Um Halbacht klingelte ich bei meinem Freund, dem Großen Vorsitzenden. Es hatte inzwischen angefangen zu regnen. Da sein Bürofenster erleuchtet war, würde er sicher auch zu Hause sein. Im richtigen Leben produzierte der Große Vorsitzende Orchideen und Wasserpflanzen im Babystadium, die er dann an Gärtnereien verkaufte. Wenn er nicht gerade den Vorsitz in Sitzungen hatte oder Orchideen nach Holland oder sonstwohin brachte, saß er meistens in seinem Büro und managte seinen Achtleutebetrieb.
Da dies seine Hauptbeschäftigung bis tief in die Nacht hinein war, stellte ich mir vor, daß er noch unbefleckt sein könnte von der Empfängnis der bewußten Nachricht. Ich freute mich darauf, sie ihm zu überbringen.
Er machte die Haustür auf und sagte wie immer: "Hallo, komm rein!"
Wir gingen in sein Büro und er fragte wie immer: "Ein Bier?"
Dabei ging er schon in die Küche und holte eine Flasche der Marke "Strong". Ich hatte mich auf dem Stuhl niedergelassen, auf dem ich immer saß, und antwortete: "Ja, bitte."
Er ließ sich mir gegenüber am Schreibtisch neben dem PC nieder und öffnete ebenfalls zischend eine Flasche "Strong". Dann bot er mir wie immer eine F6 an und gab mir Feuer.
"Vorhin rief mich jemand an", sagte er und inhallierte tief seinen ersten Zug. "Ich möchte doch bitte einmal den Fernseher einschalten."
"Ah so!" antwortete ich leicht enttäuscht. "Weißt du auch schon, daß heuteabend noch eine Veranstaltung in der Kirche stattfinden soll? Der Bürgermeister wird dich sicherlich gleich anrufen."
"Gehst du dorthin?" fragte er und runzelte die Stirn über seinen starken Brillengläsern.
"Eher nicht ...", grinste ich und hörte, daß die Regentropfen inzwischen heftiger an die Fensterscheibe klatschten.
Wortlos zog der Große Vorsitzende den Stecker des Telefonkabels aus der Buchse. Dann lachte er meckernd und wir prosteten uns zu. Hinter meinem Rücken gluckste die Umlaufpumpe des großen Aquariums und als ich mich umdrehte, sah ich, daß die Guppies mich interessiert beäugten.
"Und?" begann ich. "Was hältst du davon?"
"Sie machen viel zu viel Wind", meinte er. "Jetzt sollen es die Mohammedaner gewesen sein. Wart`s erstmal ab."
Er hatte offensichtlich einen Informationsvorsprung.
"Die Mohammedaner?" fragte ich. "Eigentlich war das ja zu erwarten. Dann werden sie wohl morgen ein paar Atombomben auf Palästina werfen."
"Glaube ich nicht", sagte der Große Vorsitzende. "Das trauen sie sich nicht."
Er bot uns die nächste F6 an und ich fragte: "Was hältst du davon, daß sie es selber waren?"
"Keine dumme Idee", sagte er. "Sie könnten damit viele Probleme bei sich und auf der Welt zu ihren Gunsten lösen. Die USA möchten die Welt besitzen. Freund und Feind sind nun genötigt, sich klar zu positionieren."
"Jedermann", sagte ich, "dem diese Schuld zugewiesen wird, ist vogelfrei."
Mein Freund kramte in seiner Schreibtischschublade und zog dann ein grünliches Stück Papier hervor.
"Hast du dir das schonmal genau angeschaut?" fragte er und hielt mir einen 1 Dollar-Schein entgegen.
"Nein", antwortete ich schlicht und goß noch etwas "Strong" in mein Glas.
"Dieses Geld ist die Weltwährung ansich", knurrte er und stieß eine blaue Qualmwolke aus. "Diese kleine Pyramide hier wird den Illuminaten zugewiesen, den Erleuchteten. Das Auge in ihrer Spitze sieht alles, auf der ganzen Welt. Big brother is watching you. Darunter steht: Novus Ordo Seclorum, das heißt: Die Neue Weltordnung. Darunter steht Annuit Coeptis, das heißt: Das Vorhaben wird erfolgreich sein. Na, ist das ein Programm?"
Er blinzelte mich erwartungsvoll an und drückte seine F6 aus.
"Es wäre nur logisch, insbesondere unter diesem Präsidenten", sagte ich langsam. "Hast du Lust auf einen Krieg gegen den Islam?"
"Warte es ab!" meinte er und wir entzündeten uns eine F6. Der Große Vorsitzende spekulierte nicht gern.
"Kommst du mit zur Dienstagsrunde?" fragte ich und lehnte eine weitere Flasche "Strong" ab.
"Ach ja, heute ist ja Dienstag", sagte er. "Nein, ich muß noch viel arbeiten. Morgenfrüh fahre ich nach Schweinfurth."
"Falls nicht Krieg ist", grinste ich.
Er lachte laut auf und brachte mich hinaus auf die Strasse.
Als ich draußen im Regen in meinem alten Auto saß, dachte ich plötzlich an meine Zwillingsschwester. Sie besaß eine ziemlich extreme Einstellung zur Gegenwart. Was mochte sie heute fühlen? Vor einigen Jahren war sie wegen eines Ossi-Typen von Kiel in diese Stadt gekommen. Sie war nicht meine wahre Zwillingsschwester, aber sie wurde am gleichen Tag wie ich geboren, Sternzeichen Zwilling, allerdings fünfzehn Jahre später.
Als sie die Tür öffnete, trug sie einen weißen Frottee-Bademantel.
"Schläfst du schon?" fragte ich.
"Nein. Komm rein!" sagte sie in ihrem leichten Westküstenakzent und umarmte mich kurz.
Im Wohnzimmer lief der Fernseher, die Tür zum Wintergarten stand offen und ihr alter Dalmatinermischling kam aus dem strömenden Regen des Gartens hereingewuselt.
Sie setzte sich auf die braune Ledercouch. In einem der braunen Ledersessel saß ihr Typ. Als er mich sah, sprang er in die Höhe und kam mir mit ausgestreckten Armen entgegen. Er war kleiner als ich und ein ziemliches Muskelpaket mit leichtem Bauchansatz. Unter den kurzgeschorenen blonden Haaren leuchteten seine blauen Augen.
"Die Dreckschweine haben eins aufs Haupt gekriegt!" stieß er lachend hervor und seine weißen Zähne blitzten. "Geil! Wirklich geil!"
Er rannte den langen Flur entlang zur Küche und kam wenige Sekunden später mit einigen Bierbüchsen zurückgesprungen. Eine warf er mir im Laufen zu und ich konnte sie gerade noch über der Glasplatte des Tisches auffangen.
Wir ließen die Verschlüsse der Bierdosen zischen und er kringelte sich wieder in seinen Sessel. Nach dem ersten Schluck schaute er mich schräg von unten an und sagte: "Oder darf ich heute sowas vor dir nicht sagen?"
"Sag was du denkst", antwortete ich und grinste.
Sein Vater war Hauptmann bei der Polizei der DDR gewesen. Der Vater meiner Zwillingsschwester war Waffenmeister bei der Bundeswehr.
Ich blickte endlich zum vor sich hin labernden Fernsehschirm. Es mußte kurz vor Neun sein, immerhin hatte ich vier Stunden lang keine Neuigkeiten zu mir genommen. Meine beiden Gastgeber schauten einen dieser privaten Sender, die ich im Waldhaus nicht empfange.
Inzwischen gab es auch ein viertes Flugzeug. Es war über Pensylvanien abgestürzt. Passagiere hatten noch während des Fluges ihre Angehörigen angerufen und sich verabschiedet. Dann hatten sie die Terroristen, die sie entführt hatten, überwältigt und das Flugzeug zum Absturz gebracht. Das war die Heldenversion. Eine andere Version behauptete zu diesem Zeitpunkt noch, es wäre von Abfangjägern der US Air Force abgeschossen worden.
Von dem ins Pentagon gekrachten Flugzeug hörte man merkwürdig wenig. (Später sollte man praktisch nichts mehr dazu hören. Es gibt Stimmen, die behaupten, dieser Vorfall sei getürkt worden. (Siehe z.B. ![]() Mathias Bröckers "The WTC Conspiracy" Teil XXXVIII - Das Pentagon-Mysterium.)
Mathias Bröckers "The WTC Conspiracy" Teil XXXVIII - Das Pentagon-Mysterium.)
Aus New York gab es viele neue Bilder. Zum ersten Mal sah ich von Nahem, wie die Flugzeuge in die Türme rasten und wie die brennenden Kerosinmassen das Stahlskelett zerschmolzen. Als die oberen Stockwerke Sekunden lang den einen Turm in sich zusammenschoben, ragte noch für einen Moment die riesige Antenne auf dem Dach wie ein Finger aus dem schwarzen Rauch gen Himmel. Der Bauschutt erzeugte eine Druckwelle, die alles in Wolken vor sich hertrieb. Die Menschen liefen in panischer Angst vor diesem Inferno weg und ich dachte nur: Wer das überlebt hat, sollte endlich ein glückliches Leben beginnen und sich nicht mehr selbst belügen.
Zu diesem Zeitpunkt hatte man bereits einen Hauptverdächtigen. Die CIA gab als Drahtzieher der Anschläge den Terroristen Osama bin Laden bekannt, einen abtrünnigen, extremislamischen Milliardär, der sich im Augenblick wahrscheinlich gerade in Afghanistan aufhielt.
Na, bitte.
Das entsprach ziemlich genau der Theorie Samuel Huntingtons. Der über 70jährige ehemalige Militärberater einer früheren US-Regierung hatte Mitte der 90er Jahre in seinem Buch "Kampf der Kulturen" behauptet, daß nach dem Ende des Kalten Krieges unser Planet von Religionskriegen erschüttert werden wird. Schon vor einigen Jahren las ich bei ihm ein Szenario zum Beginn eines III. Weltkrieges, das dem, was heute geschehen war, sehr nahe kam. Natürlich fiel der Name Huntingtons an diesem Abend recht häufig, allerdings wurde derartigen Kassandra-Rufen rundheraus eine Absage erteilt. (Daß Kassandra seinerzeit Recht behielt, wurde bedauerlicherweise nicht dazu gesagt.)
Im Gegensatz zu Samuel Huntington durfte sich Peter Scholl-Latour zum Hofnarren machen lassen. Schließlich mußten die Fernsehmacher in diesen sich ständig wiederholenden Orgien der Hysterie auch den kritischen Intellektuellen noch ein kleines Schmankerl bieten. Trotzdem, in der Retrospektive: Vielen Dank, Peter! Zwar haben die Amis Afghanistan kurz danach im Handumdrehen plattgemacht, entgegen deinen Orakeln, trotzdem gehörten deine Beiträge zu den wenigen Lichtblicken. Topp!
Die zweite große Neuigkeit war das deutsche Szenario des Innenministers Otto Schily. Die Sicherheit der zivilisierten Menschheit ist bedroht, deshalb müssen wir sie stärken. Das geht nur, indem wir ihre Feinde bekämpfen, Feinde der zivilisierten Menschheit sind zwar im Besonderen Mitglieder der unzivilisierten Menschheit, im Allgemeinen jedoch könnten sie jedermann sein. Deshalb sollte die persönliche Freiheit jedermanns gegen die Sicherheit der zivilisierten Menschheit in die Waagschale geworfen werden. In Zukunft wird jedem unbescholtenen Bürger ein Fingerabdruck im Personalausweis und eine Überwachungskamera vor der Haustür lieber sein, als unter einem einstürzenden Bankgebäude begraben zu werden.
Das denke ich aber auch ...!
"Weißt du, was das heute ist, mein Lieber?" fragte mich die Frau und reckte ihre Brüste über den Tisch.
"Sag es mir!" bat ich und nahm einen kleinen Schluck aus der Bierdose.
"Der erste Tag Armaggeddons", stieß sie hervor. "Ich zeige dir nochmal mein Buch."
Sie stand auf und holte das Buch, daß sie mir schon oft gezeigt hatte. Es war eine englische Ausgabe der Offenbarung des Johannes in illustrierter Form. Es enthielt ganzseitige Gemälde im Stil einer surrealistischen Gothik. Mit beeindruckender Ideenvielfalt war jeder Satz der Apokalypse im Bild festgehalten.
"Mich beeindruckt das da nicht besonders", sagte sie ruhig und warf einen Blick auf die Bilder im TV. "Ich habe schon darauf gewartet. Es mußte so kommen, war zwingend logisch."
Wir hatten uns schon oftmals über diese Themen unterhalten und auch mich hatten die heutigen Ereignisse nicht in übermäßiges Erstaunen versetzt, eher in einen Zustand der Neugierde, aber an einem gewissen Punkt gingen unsere mystischen Vorstellungen getrennte Wege. Überhaupt glaube ich, daß es eine weibliche und eine männliche Spielart der Mystik gibt.
Sahen wir bereits die Akteure des apokalyptischen Szenarios und konnten sie nur noch nicht zuordnen?
Wurden die Menschen heutzutage in eine so tiefe Verblendung gestürzt, daß sie inbälde das Große Tier anbeten werden, das ihnen die ewige Sicherheit vorgaukelt?
War heute der erste Tag der Letzten Schlacht, die junge Morgenröte Armaggeddons?
An dieser Stelle konnte ich mich nur auf die Position meines Freundes, des Großen Vorsitzenden, zurückziehen und sagen: "Warten wir erstmal ab."
Auf dem Bildschirm wurden die Nachrichten inzwischen zum dritten Mal wiederholt. Es ging schon auf Zehn zu. Ich gab meiner Zwillingsschwester die halbleere Bierdose: "Trink sie aus, ich will noch zur Dienstagsrunde."
Sie brachte mich an die Haustür und winkte mir nach.
Auf dem großen Parkplatz unterhalb des Burgberges stellte ich den Motor ab. Es regnete inzwischen in Strömen. Parke niemals vor einer Kneipe.
Ich rannte durch den Regen auf das kleine Pub zu, dessen Eingangsbeleuchtung mir einladend entgegen strahlte.
Hier traf ich mich oft dienstags mit einer wechselnden Runde von Menschen, um Neuigkeiten auszutauschen oder mir die Zeit anderweitig zu vertreiben. An diesem Abend war das Pub außergewöhnlich voll. Gleich vor mir in der Nähe der Theke stand meine Ex-Frau. Wir waren seit über zwanzig Jahren geschieden und seit geraumer Zeit war unser Verhältnis stark unterkühlt.
Aber heute, am ersten Tag Armaggeddons, war alles möglich. Lächelnd kam sie auf mich zu und sagte: "Hallo, wollen wir unseren Streit beilegen?"
"Ja, sehr gern!" antwortete ich aus vollstem Herzen und wir gaben uns einen Kuß mitten auf den Mund. Ihr Mann, ein Beamter und Kunstmaler zugleich, stand hinter ihr und grinste.
"Was hat euch hierher verschlagen?" fragte ich sie, während mir die hübsche kleine Wirtin einen Begrüßungswhisky schenkte.
"Wir waren bei der Lesung von Helmut Karrasek", sagten sie. Ach ja, ich erinnerte mich daran, daß der Literaturkritiker heute in unserer Stadt aus seinem jüngsten Buche lesen sollte.
"Und was haltet ihr davon?" fragte ich und wies auf die um mich herum laufenden Fernseher, die ohne Ton alle nur das Eine zeigten.
"In zwanzig Jahren werden wir vielleicht erfahren, wer es war", antwortete der Gatte, der als Zyniker bekannt war.
"Ich hoffe, schon etwas eher", gab ich halbherzig zurück.
In der tiefsten Ecke der Bar stand ein Ratskollege von mir, Entsorgungsspezialist. Wir begrüßten uns und er sagte: "Eine meisterhafte Sprengung."
Gemeinsam stiegen wir die Treppe hinauf zum Tisch der Dienstagsrunde. Die Damen und Herren unterhielten sich gerade über den Reichstagsbrand. Vor siebzig Jahren reichte es noch aus, ein Regierungsgebäude anzuzünden, um ein Volk in eine Katastrophe zu stürzen. In unserer heutigen Mediengesellschaft muß man schon ein wenig mehr Aktion erzeugen, um die Menschheit zur Teilnahme an der Letzten Schlacht zu überreden.
"Sagt mal", unterbrach ich sie, "im Fernsehen sehe ich nur bedingungslose Solidarität, aber wohin ich heute auch komme, treffe ich zynische Freude. Könnt ihr mir das erklären?"
"Können wir", lächelte der Inhaber der Sicherheitsfirma. "Wir haben eine andere Sozialisation als die Leute, die über die Geschehnisse in Amerika im Fernsehen reden. Wir haben in der Schule gelernt, daß unsere Städte 1945 von angloamerikanischen Terrorbombern zerstört wurden. Ich stand zusammen mit Vietnamesen an der Werkbank, deren Verwandte mit amerikanischem Napalm gekocht wurden und sie wußten gar nicht warum."
"Ich war nicht Aupaire-Mädchen in den Staaten", sagte die Mathematikerin.
"Und ich habe weder am MIT studiert, noch bin ich mit der Harley über den Highway 66 gedüst", fügte ihr Mann eifrig hinzu und trank sein Tonic Water.
"Und der Onkel Tobias vom RIAS hat uns auch nicht weiter geholfen", knurrte der Mann vom Sanierungsträger sarkastisch und verdrehte die Augen.
Ich mußte lachen: "Jetzt müßt ihr mir nur noch erzählen, daß wir gar nicht in diesem Pub sitzen würden, wenn wir uns nicht wegen Reagens SDI-Programm totgerüstet hätten."
"Wo er recht hat, hat er recht", brummelte mein Ratskollege und hob ermahnend den Zeigefinger.
"Glaubst du auch, daß es die Amis selber waren?" fragten mich dann alle zugleich und starrten mich herausfordernd an.
"Nun ja", antwortete ich vorsichtig. "Vielleicht waren es ja auch die Außerirdischen."
Sie verzogen abschlägig die Gesichter.
"Aber wenn nicht die", fügte ich schnell hinzu, "wozu sollten es die Amis getan haben?"
"Sie wollen die Macht", sagte der Inhaber der Sicherheitsfirma. "Die Macht über diesen Planeten, über alle seine Schätze und Menschen."
"So einfach ist das", nickte mein Ratskollege und trank ein neues Glas Hefeweizen.
"Das hatten wir heute schonmal", hakte ich ein. "Die Neue Weltordnung, das Amerikanische Imperium, Pax Americana. Eigentlich kein neuer Gedanke, nur rückt seine Verwirklichung erst heutzutage in greifbare Nähe. Mit HighTech läßt sich die Menschheit endlich lückenlos überwachen, jeder Furz wird registriert, ehe er verflogen. Jeder Befehl gelangt in Sekunden an jeden Ort der Welt. So etwas ließ sich mit Buschtrommeln und Eselskarren noch nicht realisieren. Brave New World.
Aber wieso mußten sie dafür ihre Häuser sprengen?"
"Um die Welt klar in Freunde und Feinde aufteilen zu können", belehrte mich der Mathematiker. "Man braucht einen Anlaß für den Ausnahmezustand. Die Freiheit der Individuen behindert in einer Wohlstandsgesellschaft ernsthaft die Interessen der Mächtigen. Und diese besitzen schließlich das Kapital! Außerdem benötigt man heutzutage triftige Gründe für die Führung eines Verteilungskrieges, damit die Staatengemeinschaft zustimmt."
"Ich hörte heute schon das Wort Afghanistan", sinnierte ich. "Nach Samuel Huntington wäre dort ein Bruchlinienstern der Zivilisationen. Dort stoßen der Kaspische Raum, Rußland, China, Indien, Pakistan, Persien, der Irak und die Türkei zusammen, fast neunzig Prozent aller Weltreligionen treffen hier aufeinander. Wer dieses Land kontrolliert ..."
"Möchtet ihr eure Rechnung?" fragte die hübsche kleine Wirtin.
Es war zwar noch nicht Mitternach, aber das Pub hatte sich inzwischen beträchtlich geleert. Also bezahlten wir und verabschiedeten uns voneinander.
Draußen empfing mich eine sehr regnerische Nacht.
Ich flüchtete durch den Regen in mein Auto, daß brav und ganz allein auf dem großen Parkplatz stand. Als ich es bereits in Bewegung gesetzt hatte, bemerkte ich ganz am anderen Ende der Stellplatzfläche im Schatten der drei hohen Pappeln, die der Bauwut bis jetzt noch nicht zum Opfer gefallen waren, ein zweites einsames Auto, das im Regen auf seine Besitzer wartete.
Es war mir gut bekannt. Der kobaltblaue Mercedes Combi, ein ziemlich altes Modell, gehörte einer Restauratorin, die ich schon seit der Schulzeit gut kannte und mit der Dagmar und ich oft zusammen arbeiteten. Das war völlig untypisch, um diese Zeit, bei diesem Wetter, hier mitten in der Stadt, weitab ihres einsamen Hauses. Als ich so langsam daran vorbei fuhr und in die nächste Gasse einbog, kam mir ein Gedanke.
Den Kerzengottesdienst in der Marktkirche hatte ich ganz vergessen. Er sollte spontan stattfinden im Stil der 89er Mahnveranstaltungen. Sowohl sie, als auch der Bürgermeister hatten sich damals herausragend engagiert. Vielleicht saßen sie jetzt alle noch irgendwo zusammen und schwelgten in alten Kampfeserinnerungen. Und ich war nicht dabei. Ich hielt am Straßenrand. Es war erst Halbzwölf. Wo konnten sie sein? Zwei Straßen weiter befand sich ein ziemlich nobler Weinkeller. Dort oder nirgends!
Wenig später stieg ich die Treppe zu den Kellergewölben hinab. Tatsächlich, dort saß sie und lachte mich erstaunt an. Aber nicht im Kreise der ehemaligen Umstürzler, sondern ganz allein mit ihrem Mann, dem berühmtesten Bildhauer unserer Stadt. Sie tranken Wein und freuten sich beide, mich so unverhofft zu sehen.
"Wo kommst du denn her?" fragten sie.
"Ich habe euer Auto gesehen."
"Und da wußtest du gleich, wo wir sind?"
"Ich bin nicht dumm", kokettierte ich. "Allerdings dachte ich, ihr würdet hier mit dem harten Kern des Friedensgebetes sitzen."
Sie schauten mich erstaunt an: "Das wußten wir gar nicht. Rate mal, warum wir hier sitzen!"
Mein Gehirn drehte ein paar Sekunden: "Weil ihr Hochzeitstag habt."
"Hey!" lachte der Bildhauer. "Und welchen?"
Mein Gehirn rechnete fünf Sekunden: "Den Zwanzigsten."
"Wow!" rief die Restauratorin. "Setzt du dich zu uns?"
Der Ehegatte der Inhaberin dieses Weinkellers, der eigentlich ein gestrandeter Journalist aus Bonn ist, begrüßte mich herzlich und kredenzte mir ein großes Glas teuren Rotweins. Dann ging er in ein anderes Tonnengewölbe, in dem noch eine Gruppe von Menschen , unseren Blicken weitgehend entzogen, saß und schlemmte.
Natürlich sprachen wir nun zuerst über die Ereignisse des heutigen Tages, die die beiden Künstler trotz Zwanzigjährigem aufgenommen hatten. Für mich galten sie als sehr humane und verantwortungsbewußte Menschen und ich war gespannt auf ihre Meinung.
"Mir macht das Angst", sagte die Frau. "Ich meine nicht den Anschlag der Terroristen, der sicherlich für die Betroffenen ganz schrecklich war, sondern die Reaktionen der Amerikaner, die sich jetzt bereits andeuten. Schon vor einem Jahr bei dieser dubiosen Präsidentschaftswahl merkte man, daß irgendetwas mit diesem George W. Bush nicht stimmen kann. Und jetzt wird er wohl die Katze aus dem Sack lassen."
"Ich finde es sehr bedenklich", meinte ihr Mann, "daß bis jetzt kein Wort zu den Ursachen für solch eine Handlung fiel. Die Amerikaner halten sich für dermaßen omnipotent, daß sie gar nicht auf die Idee kommen, für andere Kulturen eine Bedrohung darzustellen. Die Allgegenwart ihrer Kulturindustrie, ihrer Waren, ihres Geldes und ihrer Waffen läßt sie glauben, ihre Sicht der Welt müßte von der ganzen Menschheit dankbar entgegen genommen werden. Wenn ich schon höre, Zivilisierte Menschheit, damit wird doch impliziert, daß es auch eine unzivilisierte Menschheit gibt, Horden von Barbaren, die ihre Segnungen nicht annehmen, weil sie zu arm, zu blöde oder zu bösartig sind. Und diese Horden werden von ihnen bekämpft werden, das sage ich dir, dieses Attentat wird eine nicht endende Folge von neuen Kriegen heraufbeschwören."
"Und das ist es eben, was mir solche Angst macht", übernahm nun wieder seine Frau das Gespräch und spielte aufgeregt mit einem Crackerkeks. "Die Fremden werden sie mit Krieg überziehen und den Verbündeten, also uns, werden sie jede Kritik an sich verbieten. Und einen besseren Aufhänger als heute konnten sie sich gar nicht wünschen. Entschuldigung, aber es ist so."
Der Hausherr hatte sich inzwischen an unseren Tisch gesetzt und folgte mit aufmerksamen Kopfdrehungen dem Gespräch.
"Ihr müßt natürlich auch daran denken", begann er nun, "daß die Deutschen den Amis auch viel zu verdanken haben. Das Ende des Zweiten Weltkrieges, die Jahre danach und nicht zuletzt die Beseitigung eures Schurkenstaates."
"Weißt du", fiel ich ihm ins Wort, "erst einmal haben sich die Amis nach dem Zweiten Weltkrieg lachend mit dem Massenmörder Stalin an einen Tisch gesetzt und mit ihm einen Deal gemacht, in dessen Folge wir noch lustige 45 Jahre in diesem Schurkenstaat gelebt haben ..."
Zum Glück wurden wir in diesem Moment unterbrochen, ehe ich mir noch mehr über den Hals reden konnte, gerade als der Hausherr mit der höchstwahrscheinlichen Antwort, aber anders ging es doch nicht, noch mehr Öl ins Feuer gegossen hätte.
Die andere noch existierende Abendgesellschaft hatte sich nämlich zum Aufbruch entschlossen. Es handelte sich dabei um eine bekannte einheimische Buchhändlerfamilie und, wie wir erst jetzt bemerkten, ihren Gast Helmut Karassek, der heute in unserer Stadt eine Lesung gehalten hatte. Der Buchhändler, ein Ratskollege von mir, kam kurz an unseren Tisch geflitzt und begrüßte uns artig. Dann entschwanden sie und man hörte für einen Augenblick durch die geöffnete Außentür den Regen rauschen.
Danach schwenkte unser Gespräch in andere Bahnen und plätscherte etwa zehn Minuten dahin. Wir süffelten nun an einer guten Flasche Wein, die der Hausherr uns spendierte.
Da ging die Außentür plötzlich wieder auf, Mitternacht war bereits vorüber.
"So kann ich nicht schlafen!" rief Herr Karassek und stand etwas wirre vor uns im Raum. "Diese Fernsehbilder vertrage ich nicht."
"Setzen Sie sich zu uns", lächelte der Hausherr und erhob sich, um ein weiteres Glas zu holen.
"Es ist ganz schrecklich, diese vielen Menschen, nein ...", der Literaturkritiker sah uns mit seinen blauen Augen unter buschigen dunklen Brauen reihum an und seine Bäckchen zitterten. Dankbar und begierig griff er nach dem Glas, das ihm der Hausherr aufgefüllt reichte.
"Die Folgen werden noch schrecklicher sein", bemerkte der Bildhauer lakonisch und prostete ihm zu.
"Ja", stöhnte Karassek auf. "Es ist alles schrecklich, ganz fürchterlich."
Wir alle spürten, daß es wohl besser wäre, das Thema zu wechseln. Lieber unterhielten wir uns über unsere alte Stadt, das Fachwerk-Mekka des Weltkulturerbes der UNESCO, mit vielen Absonderlichkeiten bestückt, die wir oft gar nicht mehr recht wahrnehmen. Und dann ihre Einwohner und deren lokale Politikerschar. Manche benahmen sich so, als wäre ihnen der mittelalterliche Eichenholzbalken bereits durchs Gehirn gewachsen und andere wieder argumentierten wie die Fellachen am Rande der ägyptischen Pyramiden, die auch nichts dafür können, daß das Weltwunder ausgerechnet neben ihren Hütten plaziert wurde. Insgesamt hätte unsere Stadt eine prächtige Kulisse für einen Fellini-Film abgegeben.
Im Vergleich mittelalterlicher Stadtbilder lenkte ich das Gespräch auf Tübingen. Einen Monat zuvor hatte ich mich dort mit einem Philologen getroffen, der ein Buch über das verlorenen Atlantis herausgegeben hatte. Einige Tage lang hatten wir per pedes die Neckarlandschaft durchstreift und uns über die versunkenen Superzivilisation der Atlantiden unterhalten, die nach Meinung des Autors in einem monströsen Krieg vernichtet wurde, in dessen Verlauf geotektonische Waffen zum Einsatz kamen.
Herr Karassek hatte eine gewisse Zeit in Tübingen verbracht und wir plauderten über den dort vorherrschenden Calvinismus. Selbst heute noch gehört es dort zum guten Ton, das diejenigen Damen, die etwas auf sich halten, zu besonderen Anlässen in hochgeschlossenen Blusen erscheinen mit blütenweißen, frisch gestärkten Stehkragen. Selbst die Katholiken in seiner Heimat am Bodensee, erzählte der Literat, sind gegen die Tübinger Calvinisten ein ausgesprochen lebenslustiges Völkchen.
"In diesem Zusammenhang fällt mir ein Witz ein", schmunzelte Karassek. "Möchten Sie ihn hören?"
Eifrig stimmten wir zu.
Ein Mann wird aufgrund seiner Taten nach seinem Tode der Hölle zugewiesen.. An der Pforte empfängt ihn der Teufel persönlich, um ihm eine kleine Einführung zu geben. Er geleitet den Mann an einen weiten weißen Sandstrand, der von Horizont zu Horizont reicht. Das Meer ist herrlich blau und klar, vom azurenen Himmel scheint eine liebliche Sonne. Wunderhübsche Frauen und Männer kümmern sich um das leibliche und sonstige Wohl der Gestorbenen, wohlschmeckende Getränke werden gereicht und überall ertönt wundervolle Musik.
"Das, mein Lieber", erklärt der Teufel dem Mann, "das ist die Hölle."
Ziemlich verdutzt schlendert der Mann neben ihm her und nach einiger Zeit erhebt sich in einiger Entfernung eine kleine Felsformation, in der sich eine Tür befindet.
"Wohin führt diese Tür?" fragt der Mann.
"Ach ja", schmunzelt der Teufel. "Das muß ich dir auch noch zeigen, dann kennst du hier alles."
Er öffnet die Tür und der Mann hört laute Schreie und unmenschliches Stöhnen. Im Raum hinter der Tür lodern hohe Flammen, in denen Menschen kopfüber aufgehängt sind. Andere hocken bis zum Halse in Kesseln mit siedendem Pech oder werden von schrecklichen Monstern mit glühenden Zangen gepiesackt.
"Was ist das?" stöhnt der Mann entsetzt.
"Ach", grinst der Teufel und legt dem Mann vertraulich die Hand auf die Schulter. "Das ist nur die Hölle der Katholiken. Die wollten das unbedingt so haben."
So erheiterten wir uns mit wahren und erfundenen Anekdötchen und die erste Stunde vom zweiten Tag Armaggeddons verstrich. Dann hatte Herr Karassek die nötige Bettschwere gegen den Alptraum einstürzender Wolkenkratzer und wir verabschiedeten uns alle voneinander und gingen in unsere Betten bzw. hinaus in den strömenden Regen.
Kurz darauf lenkte ich das Auto zurück in den Wald und dachte noch einmal über Karasseks Witz nach. Die Katholiken kann man sicherlich ersetzen durch Fundamentalisten jeglicher Couleur. Sie alle versuchen, den Menschen mit Horrorvisionen auf Erden und im Himmel Angst einzujagen. Um so größer der Horror, den christliche, kommunistische, islamistische und zig andere Spielarten von Fundamentalisten uns ausmalen, um so willfähriger ducken wir uns dann unter ihre verführerisch schützenden Fittiche. Und um so monströser die manipulierte Hölle uns vorgegaukelt wird, um so dankbarer übergeben wir unsere Selbstbestimmung und unseren kritischen Verstand in die schleimigen Fänge dieser Feinde des Lebens.
Bis jetzt hatte noch immer in der Geschichte der Menschheit diese Hingabe in eine immerwährende Sicherheit für uns normale, leichtgläubige Menschlein, nicht aber für die Fundamentalisten, mit dem schmerzhaften Lodern eines Scheiterhaufens oder dem kläglichen Tod auf dem Schlachtfeld geendet.
Letztenendes war es ziemlich egal, wer die Terrorflugzeuge gesteuert hatte. Für die Fundamentalisten auf diesem Planeten war der Erste Tag Armaggeddons ein voller Erfolg gewesen.
Durch das tropfende Laub der Bäume sah ich schon von weitem, daß im Waldhaus noch Licht brannte. Dagmar war noch wach und ich erzählte ihr aufgekratzt von den Erlebnissen dieses außergewöhnlichen Abends. Als ich sie dann erwartungsvoll anblickte, wurden ihre Augen traurig.
"Ich kann dir von einer noch viel größeren Katastrophe berichten", sagte sie leise. "Hätten mich die Amis mit ihrem Debakel nicht unentwegt abgelenkt, könnte ich dir jetzt zum ersten Mal im Leben ein Stück selbstgebackenen Pflaumenkuchen anbieten. Aber so ist die eine Hälfte knorrige Kohle und die andere Hälfte ist zusammengeklatschter Matsch."
E n d e
Puschel

"Puschel"
von Christian Amling
Im vergangenen Jahr hatte Leon Kausalsky an einem Jahresend-Preisausschreiben teilgenommen. Drei Herbstausgaben einer wissenschaftlichen Zeitung trieben den Leser mit außerordentlich kniffligen Rätseln an die Schmerzgrenze seines Intellekts. (Z. B. Anfang der Recyclingkette bei Lebewesen. Lösung: Schmeißfliege. Usw.) Aber er hatte es geschafft, sich bis zum finalen Punkt der krönenden Gesamtlösung vorzuarbeiten. Fermats letzter Satz, oder besser gesagt, die famose Randbemerkung, die Generationen von Mathematikern den Schlaf raubte:
Cuius rei demonstrationem mirabilem sane detexdi
hanc marginis exiguitas non caperet
Das hieß auf Deutsch: Ich habe hierfür einen wahrhaft wunderbaren Beweis, doch ist dieser Rand hier zu schmal, um ihn zu fassen.
Zu Weihnachten hielt Leon des Rätsels Lösung in Händen und schickte sie beglückt und voller Stolz an die Redaktion der wissenschaftlichen Zeitung. Dann wartete er Monat um Monat auf eine Auflösung. Als diese dann endlich erschien, beglückte ihn nicht so sehr, dass seine Lösung zu den richtigen gehörte, denn das hatte er schon vorher gewusst, ihn erfreute vielmehr auf eine bereits ans Kindische grenzende Art und Weise, dass er zur Schar der Gewinner gehörte.
Es war der Gewinn selbst, der ihn dermaßen begeisterte. Es war kein Gyrotwister und auch keine Kurzreise nach New York und auch nicht die neueste Gesamtausgabe der Encyclopädia Britanica, obwohl er die sehr gern besessen hätte.
Nein, es war eine Tischdestille.
Nachdem er das erfahren hatte, wurde seine Geduld noch für eine erhebliche Anzahl von Wochen auf die Probe gestellt. Erst zu Beginn des Sommers, als gerade ein milder Regen auf das frische Grün inmitten des Waldes herabrieselte, wo Leon Kausalsky in einem großen alten Haus auf einer einsamen Lichtung lebte, nahte auf schlammigen Forstwegen der braune Lieferwagen von UPS. Fluchend stieg der Fahrer aus seinem dreckbespritzten Auto und bat Leon unwirsch, ihm beim Hinausbugsieren des riesengroßen Kartons behilflich zu sein. Zum Dank für sein außergewöhnliches Fahrengagement schenkte ihm Leon eine Hand voll frischer ökologischer Erdbeeren und beobachtete ungeduldig und missmutig, wie das UPS-Auto auf dem nassen Rasen wendete und dabei zu allem Überfluss seinen Kater Fritzi in ernsthafte Lebensgefahr brachte.
Dann war er endlich wieder allein auf seiner Lichtung. Zwischen hohen Kiefern stand das Haus. Davor breiteten sich Hof und Gartenfläche aus. Der leichte Maienregen hatte in den letzten Minuten nachgelassen und Leon sah, dasss wie zur Bestätigung seiner Freude über den Harzbergen die ersten blauen Himmelsflecke auftauchten. Bald darauf geriet die Sonnescheibe in das erste Wolkenloch und weißes Licht flutete auf die Erde herab.
Die zweite Tageshälfte versprach, warm und trocken zu werden. Leon, der sich am liebsten im Freien aufhielt, rückte den großen Holztisch unter der Überdachung hervor und wuchtete ihn mit einiger Anstrengung auf den sonnigen Hofflecken. Dann konnte er seine Neugier nicht mehr bezwingen. Das unförmige Mitbringsel des UPS stand noch auf dem Boden. Er begann, mit einem Küchenmesser die braunen Klebebänder aufzutrennen. Hastig öffnete er den Pappdeckel des Kartons. Zuoberst lagen einige Papiere, sicherlich die Gebrauchsanweisung und der Aufbauplan. Schnell wühlte er weiter. Die ersten Teile kamen zum Vorschein, zwischen Holzwolle und Polystyrol blitzte Metall und Glas. Vorsichtig hob Leon die rotkupferne Destillationsblase auf den Tisch. Kater Fritz beobachtete ihn dabei aus einiger Entfernung voller Misstrauen. Dann kam der Heizpilz mit dem Zuleitungskabel.
Leon kam ins Schwitzen. Die Sonne schien inzwischen von einem azurblauen Himmel. Mit einer unbewussten Handbewegung strich er die langen blonden Haare nach hinten. Sie fielen bis auf den Rücken des armygrünen T-Shirts. Die Jeans wurden ihm schon zu warm, doch glücklicherweise kühlten seine nackten Füße im noch feuchten Gras.
Bald lagen alle Teile, Kühler, Auslauf, Verbindungsstutzen in ihrer schimmernden Neuheit auf der goldbraunen Tischplatte und er begann mit dem Zusammenbau der Apparatur. Leise summte er „Mother`s Little Helper“ von den Rolling Stones vor sich hin und fügte dabei vorsichtig Teil an Teil. Handwerklich begabt war er nicht sonderlich, aber das hatte er gerade noch drauf. Und so stand dann auch bald die vollendete Gerätschaft seiner Träume vor ihm im Sonnenlicht.
Nachdem er das Verpackungsmaterial aus dem Blickfeld geräumt hatte, umkreiste er einige Male verzückt den Tisch und beschloss dann, sofort einen Probelauf durchzuführen. Im vorigen Sommer hatte er einen 20 Liter-Ballon mit Brombeerwein angesetzt, angereichert mit Hollunderbeeren und verstärkt durch braunen Zucker. Der Gärprozess war in seiner warmen Küche vorzüglich verlaufen und er hatte sich den guten Tropfen aufgespart für diesen einen Moment, der jetzt in greifbare Nähe gerückt schien.
Allerdings ist ungeteilte Freude nur halbe Freude und gerade in diesem Fall einer bevorstehenden wissenschaftlich-alkoholischen Prozedur traf diese alte Volksweisheit besonders zu. Er wusste auch schon, wen er für besonders geeignet hielt, an der Premiere teilzuhaben: Seinen Freund, den Großen Vorsitzenden. Der züchtete im wahren Leben am anderen Ende der Stadt Orchideen. Die Chancen standen gut, dass er am heutigen Freitag die nötige Zeit und Lust aufbringen würde.
Gedacht, getan. Leon rief an, der Vorsitzende sagte zu und die Zeit verging. Er schloss den Heizpilz mit einem Kabel an den Stromkreis seines Hauses an und trug ächzend den 20 Kilogramm schweren gläsernen Weinballon ins Freie. Vorsichtig zog er mit einem Gummischlauch ein Gläschen der rubinroten, klaren Flüssigkeit ab und ließ sie in einen Weinbecher fließen. Dann nippte er sachkundig daran.
Oh ja! Das Getränk war vorzüglich gelungen, der Zucker fast vollständig in Ethanol umgewandelt, kein hefiger Beigeschmack mehr, fruchtige Frische mit einem herben Hauch des letzten prickelnden Restes von Kohlendioxid.
Befriedigt lehnte sich Leon Kausalsky auf seinem Gartenstuhl zurück und hielt das Glas gegen die glühendweiße Sonnenscheibe. Klar funkelte das Licht in der süffigroten Flüssigkeit.
„Hallo, Leon!“, sagte da eine Stimme und ließ ihn leicht erschrocken zusammenfahren. Blinzelnd schaute er zum Weg hinüber. Dort nahte der Große Vorsitzende im sommerlichen Outfit: Hellkariertes Hemd, Bluejeans und Sandalen.
„Ho, ho!“, machte er, als er am Tisch angekommen war. „Das ist ja ein herrliches Gerät! Und wie schmeckt dein Gebräu?“
„Edel!“, antwortete Leon und schaute betont kritisch drein.
Ungerührt davon umkreiste der Vorsitzende den Tisch und seine Brille näherte sich immer wieder der Apparatur. Er grinste belustigt und strich sich durch die kurzen, schwarzen Haare. Dann trat er zwei Schritte zurück und fingerte eine F6 hervor.
„Hast du schon eingefüllt?“, fragte er sachkundig, denn er hantierte ständig mit Laborgeräten.
„Ich habe auf dich gewartet“, entgegenete Leon und goss Wein in ein zweites Glas. „Hier! Koste von meinem Gebräu!“
Der Freund nippte daran. Eigentlich war er passionierter Biertrinker. „Schmeckt sehr gut!“
„Dann füllen wir jetzt ein“, schmunzelte Leon befriedigt. Gemeinsam füllten sie die Destillationsblase mit Wein und fügten sie in den Aufbau. Leon schaltete den Strom ein. Nach einer kurzen Gedenkminute holte er einige aparte Schnapsgläschen aus dem Haus. Schweigend starrten sie auf die gläserne Kopfröhre mit dem Thermometer. Die Temperatur stieg und es bildete sich ein kleiner Kondensationsbelag.
„Ist das überhaupt erlaubt?“, grinste der Große Vorsitzende und hüllte sich in eine blaue Qualmwolke.
„Zum Eigenbedarf denke ich schon“, gab Leon zurück. „Warum sollten sie sonst derartige Preise vergeben?“
„Es ist bestimmt irgendwo geregelt“, überlegte der Vorsitzende, der sich mit sowas bestens auskannte.
„Ganz sicher“, sagte Leon und ließ etwas Kühlwasser laufen. „Es ist alles bestens geregelt. Wir können uns darauf verlassen, dass das Amt ganze Arbeit geleistet hat. Und bestimmt müssten wir eigentlich eine Gebühr entrichten. Nur ...“
„Nur leider ist Freitagnachmittag“, fiel ihm der Freund belustigt ins Wort, „und das Amt ist geschlossen und alle kaufen ihre Grillwürstchen. Leon! Der erste Tropfen fällt!“
Gespannt wandte sich der Angesprochene dem Auslaufstutzen zu. Dort stand bereits ein Glas. Die Kopftemperatur betrug jetzt über 80 Grad Celsius.
„Das ist der Luther“, sagte er. „Das erste Glas Destillat sollten wir nicht trinken, da kommt noch alles mögliche mit rüber.“
Ein angenehmer Geruch, der leicht an Duosan Rapid erinnerte, verbreitete sich rund um die Destille.
„Faszinierend!“, schwärmte Leon. „Weißt du eigentlich, dass die meisten Leute nicht den blassesten Schimmer davon haben, wie man die Flüssigkeiten, die sie so leichtfertig zusammen gießen, wieder auseinander kriegt?“
„Ja, das weiß ich!“, lachte der Große Vorsitzende meckernd. „Aber nicht nur das wissen die meisten Leute nicht.“
„Jedenfalls ziehen wir jetzt ganz behutsam das Ethanol aus der Flüssigkeit, die wir einst Brombeerwein nannten“, murmelte Leon und sah zu, wie sich das Gläschen langsam mit klarem Destillat füllte. Behutsam goss er die ersten Milliliter in ein Fläschchen und als dieses dann endlich gefüllt war, machte er ein sehr feierliches Gesicht. Sein Freund entzündete eine F6 und sah ihn erwartungsvoll an.
„Die nächsten Tropfen werden unser sein!“, sprach Leon. Er schaute dabei konzentriert auf den Auslaufstutzen, aus dem es jetzt ziemlich zügig rieselte. Die Sonne war inzwischen höher geklettert und der Duft nach Kiefern und Maiengrün breitete sich über der Idylle aus. Die klare Flüssigkeit, die langsam die Gläschen füllte, roch nun nicht mehr nach Duosan Rapid, sondern nach frischen Brombeeren und zugegebenermaßen nach Ethanol. Schweigend gaben sich die beiden Männer der Wirklichkeit dieses naturwissenschaftlichen Phänomens hin. Bald bedeckten in jedem Glas vielleicht vierzig Milliliter den Boden. Mit einer schwungvollen Bewegung, gepaart mit Ungeduld, zog Leon sie hervor und reichte eins davon dem Großen Vorsitzenden. Die beiden Männer schauten sich in die Augen und Leon intonierte: „Auf eine brombeerige Sommerzeit!“
„Auf dass er bekömmlich ist!“, prostete sein Freund zurück. Dann nahmen beide einen kleinen Schluck. „Ah!“, machten sie und tranken die Neige leer.
„Das ist ein vorzüglicher Tropfen!“, lobte der Gast. Leon erwiderte: „Ich fülle uns noch eine Kostprobe ab.“
Nach cirka einer Stunde und einer für kältere Zeiten abgefüllten Flasche Brombeergeist, sowie zwei angenippten Gläsern weiter, war die Atmosphäre auf der Lichtung sommerlich. Schmetterlinge flogen von Blüte zu Blüte, Bienen surrten und die Vögel stritten sich lauthals um Weibchen und Reviere. Die Männer unterhielten sich über die unseligen Entwicklungen in der Lokalpolitik und rückten ihre Stühle ein wenig in den Schatten einer Kiefer.
Da begann es.
Ein leises, Aufmerksamkeit einforderndes Maunzen ertönte wenige Schritte von den plaudernden Männern entfernt. Es klang etwas merkwürdig, anders als man es sonst von Kater Fritz gewöhnt war. Leon hielt im Sprechen inne und schaute auf den Katz. Das Tier saß vor ihnen im Gras und hatte vor sich eine Beute abgelegt.
Leon musste eine ganze Weile hinschauen, ehe er mit unsicherer Stimme hervorbrachte: „Was ist denn das?“
Auch der Große Vorsitzende hatte sich jetzt nach vorn gebeugt und blickte mit zusammen gekniffenen Augen auf das Etwas, das vor Kater Fritzi lag. Dann meinte er verwirrt: „Soviel haben wir doch gar nicht getrunken.“
In der Tat war der Anblick höchst seltsam. Das fellige Bündel, das da vor einem jetzt anklagend guckenden Fritzi in den grünen Halmen lag, war zweifellos ein Tier von der Größe eines ausgewachsenen Hamsters. Hamster bekommt man zwar kaum noch zu Gesicht, aber es war der beste Vergleich. Nicht so groß wie eine Katze, nicht so klein wie eine Ratte und nicht so gedrungen wie ein Wildkaninchen. Nein, es besaß einen armstarken, langgestreckten Körper wie ein Feldhamster. Aber seine Farbe war nicht gelb-braun-schwarz, sondern weiß. Es war das seltsamste Weiß, das sich die Männer vorstellen konnten. Es war so weiß, so leuchtend, so irritierend. Und das Fell war struppig, lang und irregulär. Und am Kopf sah man keine echten Augen, sondern Hörnchen, undefinierte Ausstülpungen. Nun ja. Aber das seltsamste von allem war, dass dieses Tier drei Paar Beine hatte, pelzige, behaarte, kleine Beine mit Gelenken. Aber sechs Stück.
„Das ist doch unglaublich“, flüsterte Leon und beugte sich nach vorn, um besser sehen zu können.
„Es lebt noch!“, sagte sein Freund, der von Haus aus Biologe war. Tatsächlich hoben sich die Flanken des Wesens in einem schnellen, flachen Rhythmus. Die kleinen Pfoten zuckten hin und wieder spastisch in der Luft. Es war klar, dass Fritzis Beute bereits einen wohl kaum reparablen Schaden davongetragen hatte. Der Große Vorsitzende nahm die Brille ab und wischte sich die Augen. „Wir müssen das haben!“
Ohne zu zögern, stand Leon auf und beugte sich zu dem Tier hinab. Mit bloßen Händen griff er danach. Aber Fritzi war schneller. Der Kater packte mit seinen kleinen Zahndolchen das unwirkliche Lebewesen und rannte mit ihm quer über den Hof. Wie der Gepard eine junge Gazelle trägt, so schleifte Fritzi das Tier mit hoch erhobenen Kopf zwischen seinen Vorderbeinen. Er erreichte den Stamm einer dicken Kiefer und ehe Leon reagieren konnte, kletterte der Katz samt Beute daran empor bis auf das Schuppendach aus Teerpappe. Dort endlich ließ er das Wesen fallen, weitgehend verborgen vor den Augen der Menschen.
Leon hielt enttäuscht inne und schaute hinauf. Fritzi zauderte nicht lange und begann, seine mysteriöse Beute zu zerlegen. Knirschend zersplitterten kleine Knöchelchen. Dann schlang er Teil für Teil in sich hinein, so wie er es sonst mit Mäusen und Vögelchen tat. Dabei stieß er ein teils drohendes, teils wollüstiges Knurren aus. Der Große Vorsitzende war inzwischen auch angekommen und starrte hinauf zu dem animalischen Gelage.
„Wir müssen deiner Katze das Tier entreißen“, sagte er aufgeregt. „Das ist irgendein absolut seltener Mutant. Nun tue doch etwas, Leon!“
„Fritzi!“, schrie dieser nun und fuchtelte mit den Armen umher. „Fritzi! Pfui! Lass das!“
Er sah sich nach einer Leiter um. Und je aufgeregter er wurde, um so schneller schlang Fritzi seine Beute hinter. Endlich griff Leon in seiner Verzweiflung nach einem Knüppel, der zwischen den Beeten lag. Er drohte damit dem Katz, aber als der nicht reagierte und würgend die letzten Bissen abschluckte, warf er voller Wut den Stock aufs Schuppendach hinauf. Entsetzt und beleidigt machte Fritzi einen Sprung in den Hintergrund und beäugte aus unerreichbarer Position sein Herrchen. Von dem merkwürdigen Wesen war nicht der kleinste Rest übrig geblieben.
„Scheiße!“, sagte der Große Vorsitzende und ging zurück zur Destille. Auch Leon eilte dorthin, denn während der Aktion war das unter den Auslauf gestellte Glasgefäß übergelaufen und der Geist der Brombeere ergoss sich bereits seit geraumer Zeit unwiederbringlich über die Tischplatte. Hastig hantierte der Hausherr mit Trichtern und Flaschen und nachdem der Schaden eingedämmt war, füllte er wieder zwei Glaserl und reichte eins davon seinem Freunde. Schweigend stießen sie an und tranken auf den durchlebten Schrecken. Doch das war nur das Vorspiel gewesen.
Als sie ihre Gläschen abgesetzt hatten und sich aus tränenden Augen ansahen, wurden ihre Sensorien plötzlich durch eine Bewegung nahe der Grundstückgrenze abgelenkt, dort wo die mit zartem Grün bepflanzten Beete übergingen in die Natur des Kiefernwaldes. Für einige Sekunden konnten ihre Sinnesorgane die Information, die dort im sonnenflirrenden Halbschatten auf sie lauerte, nur mit Mühe einordnen. Dann überwältigte beide Männer ein eiskalter Schrecken. Die Haare an ihren Körpern richteten sich steil empor und sie starrten fassungslos auf die Gestalten.
Es waren fünf oder sechs. Sie waren etwa zwei Meter groß und durchaus humanoid, etwa so, wie große, dürre Männer ausgesehen hätten. Aber das waren sie nicht. Die Körper waren gehüllt in eng anliegende schwarze Anzüge. Es sah aus wie das schmierig glänzende Blauschwarz von Grafit. Unbekannte Ausstülpungen oder Gerätschaften hafteten an diesen Bekleidungsstücken. Wahrscheinlich besaßen sie irgendeinen funktionalen Charakter.
Die Köpfe dieser Wesen waren groß, große Gehirne, aber spitze Gesichtspartien. Über kleinen, schnauzenartigen Mündern und Nasen befanden sich sehr große, dunkle Augen. Die Farbe der Haut war tief braun oder violett und die voluminösen, haarähnlichen Strähnen, die die Schädel umgaben waren rabenschwarz. Schweigend standen sie da und starrten zu Leon und seinem Freund herüber. Dahinter auf einer Lichtung im Wald stand etwas, das dort nicht hingehörte, etwas ziemlich ausgedehntes, finsteres, das aussah wie ein Felsen und über dem die Luft irgendwie zu flirren schien, so als wäre sie sehr erhitzt.
Leon fühlte sich völlig paralysiert. Er konnte sich vor Schreck nicht bewegen. Seine Zunge lag wie eine Weinbergschnecke in der Mundhöhle und seine Füße klebten bleiern im Gras. Dem Großen Vorsitzenden schien es nicht viel anders zu ergehen.
Jetzt machte das größte dieser Monster einen Schritt nach vorn und sank leicht ein in das frische Grün von Leons Beet. Es hob einen langen, dürren Arm mit einer sehr gelenkigen, dunklen Hand wie zum Gruße und sagte mit einer wie künstlich modulierten Stimme: „Menschen!“
Leon starrte das Wesen an und brachte weder eine Bewegung noch gar eine Erwiderung zustande.
Nach kurzem Abwarten knorrte das Wesen: „Wir wollen unseren Puschel wiederhaben!“
Leon saß wie angestemmt auf seinem Gartenstuhl und glotzte von unten hinauf zu dem etwas mehr als fünf Meter entfernten Wesen. Er hatte sich das so nicht vorgestellt, den Kontakt. Und nicht heute. Er war nicht in der Lage, irgendetwas zu sagen.
Das Wesen bewegte die dunkle Hand einmal waagerecht hin und her, so als wolle es etwas unterstreichen. Dann knorrte es, schon wesentlich nachdrücklicher: „Gebt uns unseren Puschel zurück, ihr Menschen!“
Der Große Vorsitzende hatte seine Lähmung offenbar gerade überwunden, denn er stammelte: „Den hat die Katze gefressen!“
Durch die Gruppe der Wesen ging eine kaum merkliche Bewegung. Einige Köpfe neigten oder drehten sich leicht wie Blätter im Wind. Zeit verging. Dann knorrte der Vorsprecher: „Tötet diese Katze!“
Leon drehte wie in Zeitlupe den Kopf zum Schuppen. Fritzi war nicht mehr zu sehen. Mühsam löste er sich von dem seltsamen Zwang, der ihn in Bann hielt, und sagte: „Ich töte meinen Fritzi nicht!“
Jetzt kam die Antwort des Wesens sofort und Leon sah, das in dessen Mund spitze, weiße Zähne blitzten. „Tötet die Katze oder bringt uns unseren Puschel!“
„Ich töte ihn nicht!“, rief jetzt Leon, der befreiende Wut in sich aufsteigen fühlte. „Er hat ein Tier gefressen. Das entspricht seiner Natur. Wenn ihr intelligent seid, müsst ihr wissen, dass eine Rache in diesem Fall sinnlos ist!“
„Töte ihn!“, knorrte das Wesen mit hallender Stimme. Die anderen befanden sich in einem leise wogenden Bewegungszustand, kamen aber nicht näher.
„Auf keinen Fall“, erwiderte Leon und überlegte krampfhaft, was zu tun sei. „Wenn ihr ihn töten wollt, dann tut es selber und seid verflucht!“
Irgendwie erschienen ihm diese Aliens irreal. Er spürte einerseits Angst, aber andererseits musste er ihnen Widerpart bieten. Fritzi war inzwischen hinter dem Schuppen im Gebüsch verschwunden. Leon hoffte, dass er entkommen würde. Um sich selber machte er sich seltsamerweise keine Sorgen.
Das Wesen starrte noch vielleicht eine Minute auf sie herab. Dann bewegte es die Hand wieder in dieser imaginären Horizontalen. Und dann knorrte es feierlich: „Dann soll diese Welt vernichtet werden.“
Die Wesen drehten sich daraufhin abrupt um und stapften durch die Bäume davon, direkt auf jenen großen, dunklen Stein zu. Sie marschierten schnell und völlig lautlos und verschwanden dann hinter dieser unbekannten Struktur.
Der Große Vorsitzende räusperte sich verwirrt, doch in diesem Moment erhob sich die Masse mit einem dünnen Klingen vom Boden. Sie schwebte so groß wie eine riesige schwarze Linse zwischen den Bäumen. Dann verschwand sie mit unvorstellbarer Geschwindigkeit in den Weiten des blauen Frühlinghimmels.
Leon und der Große Vorsitzende wandten einander mit einer synchronen Bewegung die Köpfe zu und einer von ihnen griff mechanisch nach dem bereits wieder gefüllten Schnapsgefäß. Wortlos verteilten sie das Getränk auf die Gläser. Und wortlos kippten sie die klare Flüssigkeit hinter.
„Uff!“, raunte der Große Vorsitzende. „Was war denn das?“
„Ich fürchte, das war ein UFO“, brachte Leon mühsam hervor, vor Nervosität kichernd, „und wir haben den Kontakt vermasselt.“
„Quatsch!“, sagte sein Freund und entzündete mit heftig zitternden Händen eine F6. „Sowas gibt’s doch gar nicht. Es muss an deinem Schnaps liegen.“
Dann versuchte er, befreiend zu lachen, aber es gelang nicht so recht. Deshalb goss er sich lieber noch ein Glas voll. Leon wusste nicht, was er sagen sollte. Sein Kopf schmerzte plötzlich. Er fühlte eine Berührung am Unterschenkel und schaute hinab. Fritzi hatte sich lautlos herbei geschlichen und köpfelte um Zuneigung bettelnd an seinem Bein. Der Wald war voll von Wärme, Düften und Tiergeschrei.
Mit dieser Episode war der Kontakt zwischen Leon Kausalsky und seinem Freund, dem Großen Vorsitzenden, auf der terrestrischen Seite, und den Begleitern des sechsbeinigen Puschel auf der extraterrestrischen Seite für die beiden Brombeergeist-Destillateure abgeschlossen. Nur noch hin und wieder gaben sie die Geschichte in launigen Runden zum besten, wobei Leon die Begebenheit gern etwas ausschmückte, während sein Freund ihn dabei stets ein wenig zu bremsen versuchte.
Nicht abgeschlossen allerdings war diese Episode für den Planet Erde, auf dem sich die wesentlichen Dinge in etwas ausgedehnteren Zeiträumen entwickeln. Lange nachdem die beiden Freunde zu Staub zerfallen waren, raste die „Zeitfresser“ immer noch mit annähernder Lichtgeschwindigkeit durch das schwarze All. Die Diener Puschels waren sich nach dem dramatischen Zwischenfall auf einem unbedeutenden Planeten einer schwächelnden gelben Sonne am Rande der Galaxis sofort einig gewesen, dass dieser Fall eine ernsthafte Sühnemaßnahme verlangte. Es ging nun nur noch darum, ob man dieses Sonnensystem eliminieren sollte oder nur den Planeten.
Die Besatzung hatte unverzüglich Kurs eingeschlagen auf den Planeten für Recht und Ordnung im bewohnbaren Sektor Drei dieser Galaxis, etwa 498 Lichtjahre von der Sonne entfernt. In eine wachsartige Masse eingegossen harrten die Expeditionsteilnehmer in tiefer Hibernation dem Ende ihrer Reise. Nach umgerechnet annähernd 500 irdischen Jahren erwachten sie körperlich erfrischt aus ihrem Schlaf und landeten noch rechtzeitig genug auf ihrer Zielwelt, um eine Verhandlung über ihren Fall zu beantragen. Es war nämlich so, dass der Planet für Recht und Ordnung bei seiner komplizierten Bahn um fünf Sonnen nur jeweils einige zig Jahrzehnte zugänglich war für Lebensformen, die sich aus Kohlenwasserstoffen zusammensetzten. In den Jahrtausenden zwischen derartigen Perioden konnten hier Kulturformen auf Silizium- oder Kristallbasis, sowie die ausgedehnten Maschinenzivilisationen die Rechtssprechung nutzen.
Die Besatzung hatte Glück. Bereits nach weniger als zwei Umläufen standen sie vollzählig vor dem Oberweisen Rat der Vereinigten Richter dieses Sektors und trugen ihr Anliegen vor. Der Spruch des Gremiums war unverrückbar und absolut bindend.
Als die Oberweisen vernahmen, dass es in diesem Fall um die Tötung eines Puschels ging, erfüllte kaum unterdrücktes Getöse die gewaltige Gerichtsgrotte. Zwar entstammten Richter und Zuschauer den verschiedensten Kulturen, (deren nähere Beschreibung wir hier leider einsparen müssen), trotzdem waren sich alle bald über die besondere Schwere des Deliktes einig. Immerhin wurde die Elimination des Gesamtsystems des Fixstern Sonne relativ schnell verworfen, und zwar wegen der unverhältnismäßig starken Auswirjungen auf das nahe liegende System Proxima Centauri. Die Verhandlung nahm eine gewisse Wendung, als es um die Zerstäubung des in Frage kommenden Planeten ging. Einer der Richter, der von einer erdähnlichen Welt des nur wenige Lichtjahre von der Sonne entfernten Systems Epsilon Eridani stammte, (deren Gesellschaft der Verehrung von Puscheln ambivalent gegenübersteht), bewirkte durch ein Veto erster Ordnung, dass die letztgültige Fassung des oberweisen Richterspruchs überaus milde ausfiel: Es bleibt der Gnade der Besatzung überlassen, ob sie den betreffenden, unbekannten Planeten zerstäubt in seiner Gesamtheit oder ob sie nur den verworfenen Kontinent des Verbrechens aus dem Gesicht dieser Welt schmilzt.
Nicht ganz zufrieden mit diesem Richtsspruch, aber voller Zuneigung und Hingabe gegenüber den Oberweisen, zog sich die Besatzung zurück.
Wenig später hob die „Zeitfresser“ ab und verließ mit annähernder Lichtgeschwindigkeit das System der Fünf Sonnen. Die Besatzung schmolz sich unverzüglich in Wachs ein und versank in tiefe Hibernation, aus der sie erst in 500 irdischen Jahren wieder erwachen würde.
Am 24. Dezember 3007
Ganz sanft wogte der Fliegende Teppich in der milden Luft über der Küste. Die Oberseite war in Orange getönt und mit tiefroten Fantasieornamenten geschmückt. Es gab viel Platz in den Ferien zum Sonnen und zum Faulenzen. Jaffa hatte gerade ein niedliches kleines Weihnachtsbäumchen mit bunten Tierchen aus Capriooxidat geschmückt. Bei den vorherrschenden Temperaturen war sie völlig unbekleidet und bot ihren noch makellosen Körper der gleißenden Wintersonne dar. Sie war immerhin erst siebenundsechzig. Ihre Mutter war heute ihr einziger Gast. Mit ihrem Gerede von alten Zeiten ging sie ihr ein wenig auf den Geist. Die alte Dame saß unter einem Sonnenschirm, denn mit einhundertdreiundachtzig verträgt man nicht mehr so viel Licht. Wie immer erzählte sie längst bekannte Anekdoten aus ihren dreizehn Ehen.
Ohne recht hinzuhören, schaute Jaffa hinab auf die Landschaft. In einiger Entfernung lagen die Berge im Dunst des Vormittags. Davor befand sich der Felsen mit Quedels Burg. Das war eine uralte Anlage, die vor zweitausend Jahren von den Quedeln erbaut wurde. Die Archäologen meinten, dass das ein Stamm intelligenter Hunde war, die vor fast tausend Jahren von den Menschen ausgerottet wurden. Einige letzte Quedel sollen angeblich noch weit hinter dem Äquator hausen. Jedenfalls befand sich vor dieser netten Anlage die Museumslandschaft. Das waren steinalte Kästchen mit putzigen Formen, in denen einst Quedel und Menschen lebten. Sie waren allesamt detailgetreu nachgebildet in buntem Capriooxidat wie ihr Weihnachtsbaumschmuck.
Direkt unter ihr befand sich ein schönes Feriendorf, die Furt der Diten. Lustige Namen hatten die hier. Am Rande der luxuriösen Appartements mündete ein Flüsschen in den Atlantik. Das war die Boda, sie kam aus den Bergen und floss an Quedels Burg vorbei.
Und dann kam das Meer. Das herrlich blaue Wasser schwappte in leichten weißen Wellen auf den Kilometer langen Strand aus hellem Sand und dem Kies der Boda. Es war ein herrlicher Anblick von hier oben. Jaffas Blick schweifte hinüber zu den beiden langgestreckten Inseln Huy und Hakel, auf denen zwischen Palmen kunstvoll aufgestellte Hotelkomplexe emporragten. Dort wohnten viele Menschen aus Sibirien und Lappland und selbst aus dem fernen Grönland, die in der kühlen Jahreszeit hier ihren Urlaub verbrachten. Jaffa und ihre Mutter waren Weltenbummlerinnen. Momentan lebten sie im Ural, wo ihnen eine gut laufende Molybdän-Mine gehörte und ihre Brüder Brat-Pinguine züchteten. Ach, das Leben war eigentlich schön.
Andere Fliegende Teppiche wiegten sich in der Nähe, mal höher und mal tiefer als der ihre. Jaffa winkte hinüber, die meisten Bewohner kannte sie. Vielleicht würden sie heute noch eine abendliche Strandfeier auf Huy machen. Sie schaute hinüber zu ihrer Mutter, die auf derartigen Partys immer kein Ende fand. Die alte Dame hatte schon wieder Frenzi beim Wickel. Frenzi war ein Tinger aus Quedels Burg. Er sah fast wie eine Katze aus, war aber in Wirklichkeit eine tausend Jahre alte Züchtung von zwei mythologischen Typen aus dem Mittelalter. Immer musste Mutter mit dem murkeln. Auch jetzt streckte Frenzi begeistert seine sechs Beinchen in die Luft und lispelte irgendwelchen Schwachsinn.
Jaffa dehnte ihren schönen, braun gebrannten Körper und ging zur Kühlbox, um sich ein Sibiriabräu heraus zu nehmen. Begierig hielt sie die kalte Flasche in der heißen Hand. Geschmeidig richtete sie sich wieder auf, als nichts mehr um sie herum existierte. Außer strahlendem Weiß. Quedels Burg, der Diten Furt, die Boda, ihre Mutter und Frenzi, Jaffa und der Fliegende Teppich waren genau in diesem Zeitpünktchen verdampft.
E n d e
Copyright © 2018 · All Rights Reserved
Christian-Amling